Flexible Produktion und Logistik: ein Muss für kleine und mittlere Unternehmen
Flexible Produktionssysteme ermöglichen es Unternehmen, schnell auf veränderte Marktbedingungen und individuelle Kundenbedürfnisse zu reagieren. Anpassungsfähigkeit ist ein entscheidender Vorteil in einer von hoher Produktindividualisierung, Nachfrageschwankungen, intensivem Wettbewerb und wechselnden (handels-)politischen Vorgaben geprägten Zeit. Agile Produktionssysteme stellen KMU scheinbar vor Herausforderungen, da der Mittelstand häufig mit begrenzten Ressourcen wirtschaften und dennoch wettbewerbsfähig bleiben muss. Flexibilität ist jedoch kein »Luxus« für Großunternehmen, sondern eine strategische Notwendigkeit – auch und gerade dann, wenn die Margen knapp und die Stückzahlen niedrig sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Logistik.


Die Institute Fraunhofer IWU und IPA haben eine Methodik entwickelt, die Unternehmen durch einen strukturierten Prozess dabei unterstützt, Potenziale der flexiblen Produktion zu bewerten und schrittweise umzusetzen – auch ohne Großinvestitionen. In vielen Fällen können vorhandene Ressourcen (Maschinen, Anlagen, Prozesse, Mitarbeitendenqualifikationen) weiter genutzt werden. Modulare und mobile Komponenten helfen, den Maschinenpark für verschiedene Produkte einzusetzen und bei Bedarf kostengünstig zu erweitern oder zu reduzieren (Skalierbarkeit). In vielen Branchen konnten für typische Ausgangssituationen bereits schnell umsetzbare Lösungen entwickelt werden. Lösungen, die sich bedarfsgerecht auf unterschiedliche Unternehmensgrößen skalieren und Branchen anpassen lassen.
Beispiel Reparaturwerk: Ablösung eines Linienkonzepts durch ein skalierbares Produktionssystem, mit Versorgung über ein Hochregallager
Klassische Produktionslinien mit bandnaher Versorgung sowie festen und kurzen Taktzeiten stoßen schnell an ihre Grenzen – wenn es um ein Produktionsprogramm geht, das nicht nur viele Varianten (unterschiedliche Bauteile) in einen Takt »pressen« würde, sondern auch unterschiedliche Fertigungsreihenfolgen erzwingt. Müssen zusätzlich besonders große Bauteile untergebracht werden, verkehren sich die Vorzüge eines Linienkonzepts wie hohe Stückzahlausbringung von (weitgehend) identischen Produkten bei kurzer Fertigungszeit in ihr Gegenteil: Es ist zu starr, um größere Varianz zu erlauben und beansprucht viel Fläche für die Versorgungslogistik – jedes benötigte Teil muss von einem mehr oder weniger festen Zwischenlagerplatz zu einem festgelegten Punkt in der Linie gebracht werden.
Dieser Befund gilt in besonderem Maße für Reparaturwerke, die Bauteilgrößen im Bereich von bis zu zwei Metern Länge und Breite handhaben. Umfasst das Reparaturportfolio Produkte, die über mehrere Modellgenerationen hinweg gefertigt wurden, ist der Bedarf an Lagerkapazität für aufzubereitende oder auszutauschende Teile besonders hoch. Steht dann auch nur veraltete Fördertechnik zur Verfügung, ist es an der Zeit, über sinnvolle Automatisierungslösungen nachzudenken.
Hauptansatzpunkt für das Projektteam am Fraunhofer IWU war folglich die Logistik mit einem automatisierten, mehrstöckigen Hochregallager. Ziel war es, den Materialfluss zu flexibilisieren, die Produktionsstationen direkt über das Lager anzubinden und unterschiedliche Bauteiltypen sowie Stückzahlen effizient zu handhaben. Mithilfe einer Materialflusssimulation in Siemens Plant Simulation wurden verschiedene Szenarien modelliert und Schlüsselkennzahlen wie Durchsatz, Durchlaufzeit und Auslastung der Regalbediengeräte (automatisierte Transportsysteme zur Ein-/Auslagerung) bewertet. Die Simulation zeigte, dass ein Logistikkonzept mit automatisiertem, mehrstöckigen Hochregallager sowohl die geforderten Leistungskennzahlen erfüllt als auch skalierbar und flexibel auf sich ändernde Produktionsanforderungen reagieren kann. Herausforderungen wie variantenbedingte, individuelle Prozessreihenfolgen wurden im Modell berücksichtigt und Leistungsparameter des Hochregallagers wie Durchsatzrate, Durchlaufzeiten, Auslastung und Pufferbestände optimiert.
Beispiel Flugzeugtüren: mit neuem Material- und Fertigungskonzept Herstellzeiten um das mehr als zwanzigfache reduzieren
Die Herstellung von Türen für Passagierflugzeuge ist überwiegend Handarbeit. Viele Zwischenschritte sind erforderlich, um den direkten Kontakt unterschiedlicher Materialien zu vermeiden, der zu Korrosion führt. Werden statt Aluminium, Titan und Duroplasten hauptsächlich thermoplastische Kohlefaserverbundmaterialien (CFK) eingesetzt, die ohne Trennlagen automatisiert miteinander verschweißt werden können, geht es wesentlich schneller – die Fertigungszeit für die Türstruktur sinkt von 110 auf nur noch 4 Stunden. Dies zeigte ein Forschungsprojekt von Fraunhofer IWU, Fraunhofer LBF, Trelleborg und Airbus Helicopters.
Ein Schlüssel zu kürzeren Montagezeiten liegt außerdem in der modularen Bauweise für unterschiedliche Flugzeugtürvarianten. Das Projektteam konzentrierte sich dabei auf Bauteile in verschiedenen Türmodellen, die vereinheitlicht werden können. Dazu zählt beispielsweise der Querträger. Die Forschenden entwarfen eine vollautomatische Montagelinie für die gängigsten Modelle und entwickelten Vorrichtungen sowie Spannelemente, die für die Fügetechnologien Widerstandsschweißen und Ultraschallschweißen geeignet sind.
Das IWU-Team simulierte alle technischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte der neuen Montagelinie – die sich meist wechselseitig bedingen. Zu den wichtigsten technischen Bewertungskriterien zählen die Komplexität von Produkt und Produktionsprozess, Automatisierungschancen und -risiken auch aus dem Blickwinkel von Flexibilität und Wandlungsfähigkeit oder die Gesamtanlagenverfügbarkeit in einer Kette verschiedener Einzelautomatisierungen. Ergebnis: Unter Berücksichtigung aller technischen, logistischen und betriebswirtschaftlichen Kriterien sollte die neu entwickelte Automatisierungslösung umgesetzt werden.


Beispiel AutoLog: effiziente Kommissionierung bei hohen Stückzahlen dank fahrerlosen Transportsystemen, die Roboter mit Anbauteilen versorgen
Effiziente Kommissionierungsprozesse sind essenziell für die Just-in-Time-Produktion, besonders bei hoher Variantenvielfalt und großen, schweren Bauteilen. Klassische Automatisierung ist in diesem Bereich oft unflexibel, teuer und schwer skalierbar.
Die dynamische Kommissionierung hingegen verfolgt ein »Ware-zum-Roboter«-Prinzip und nutzt fahrerlose Transportsysteme (FTS) sowie ein anlagennahes Lager für hohe Flexibilität und Variantenvielfalt. Die Skalierung erfolgt durch einfache Erweiterung der Roboterzellen und FTS-Flotte, wobei der Staplerverkehr vollständig entkoppelt ist. Die Softwarelösung AutoLog, eine gemeinsame Entwicklung des Fraunhofer IWU und der Volkswagen AG, ermöglicht bei Volkswagen Slovakia die Konfiguration und Steuerung solcher Zellen im Self-Service und optimiert die Prozesse mit intelligenten Algorithmen. AutoLog erlaubt das initiale Design von Roboterzellen, steuert Roboter, Sicherheitstechnik und FTS, minimiert Wartezeiten und integriert Werkzeuge zur Fehleranalyse. Die virtuelle Inbetriebnahme erfolgt über eine Software-in-the-loop-Simulation zwischen AutoLog und einem Simulationsmodell in Siemens Plant Simulation. Dies ermöglicht die frühzeitige Bewertung neuer Anlagenkonfigurationen noch vor deren Betrieb.
Weiterführende Informationen
- Webinar zur Matrixproduktion mit Umsetzungsbeispielen aus der Industrie (21. Oktober 2025): Informationen und Anmeldung
- Das Fraunhofer IWU unterstützt Unternehmen bei der Einführung eines flexiblen und digitalisierten Produktionssystems. Wichtige Impulse setzt der Blog »Fabrik der Zukunft«. Die LinkedIN-Gruppe »Matrix-Produktion« steht allen Interessierten offen.
Automatisierte Montage-/ Fügeprozesse bzw. Logistik von Flugzeugtüren im Projekt »TAVieDA« . © Fraunhofer IWU
Simulation der Bandversorgung für eine variantenreiche Produktion . © Fraunhofer IWU
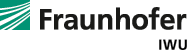 Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU