Drähte aus Formgedächtnislegierungen (FGL-Drähte) zeigen ein deutliches Einlauf- bzw. Degradationsverhalten, wodurch sich ihre funktionalen Eigenschaften im Betrieb verändern. Für die gezielte Auslegung von Aktoren ist es daher entscheidend, dieses Verhalten zu kennen und in die Auslegung einzubeziehen.
Am Fraunhofer IWU wurde hierfür ein spezieller Versuchsstand samt Methodik entwickelt, mit dem sich die funktionale Degradation von Aktordrähten charakterisieren und auswerten lässt. Der Prüfstand verfügt über drei Spuren, auf denen Aktordrähte mit individuell einstellbaren Last- und Aktivierungsparametern zyklisch beansprucht werden können.
Die Lastparameter umfassen:
- Stellweg und Stellkraft (respektive Dehnung und mechanische Spannung)
- Zyklenzahl
Die Stellkraft wird über speziell angefertigte Gewichte auf die Drähte aufgebracht, um eine konstante Last zu simulieren. Der Stellweg bzw. die Dehnung lässt sich individuell einstellen und wird mithilfe eines Laserwegmesssystems erfasst und aufgezeichnet.
Die Aktivierung der Drähte erfolgt über zeitlich gesteuerte Stromsignale, die auf das jeweilige Drahthalbzeug angepasst werden. Zusätzlich ermöglicht externe Messtechnik die Aufzeichnung des Drahtwiderstands während des Zyklierens sowie die Überwachung der Umgebungstemperatur.
Ziel ist es, mit möglichst geringem experimentellem Aufwand aussagekräftige Messdaten zu gewinnen. Diese Daten werden anschließend mithilfe mathematischer Regressionsmodelle genähert, um die funktionale Degradation im Arbeitsraum vorherzusagen und die Drahtaktoren zielgerichtet auszulegen.
Leistungsfähigkeit und Messgenauigkeit
- bis zu 3 Aktordrähte individuell zyklierbar (bis zu 200 mm Länge)
- Messung der zyklischen Veränderung von
- Stellweg
- Widerstand in Hoch- und Niedertemperaturphase
- Umgebungstemperatur
Variable Lastsimulation
- Konstantlast durch speziell gefertigte Gewichte auf individuellen Stufen
- Einstellung des Stellwegs auf 0,125 mm genau
- Durchführung von Kurz- und Langzeitversuchen
Variable Aktivierungsparameter
- Konstantstromversorgung zur zeitlich geregelten Aktivierung der Drähte
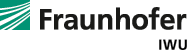 Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU


