Thermische Formgedächtnislegierungen (FGL) sind thermosensitive Werkstoffe, die ihre Geometrie in Abhängigkeit vom Erreichen definierter Temperaturen verändern und in bestimmten Temperaturbereichen elastische Eigenschaften aufweisen. Der sogenannte Formgedächtniseffekt ist bereits seit den 1930er Jahren bekannt, als der schwedische Chemiker Arne Ölander diesen an Gold-Cadmium-Legierungen nachweisen konnte. Produkte, die sich den Effekt gezielt zunutze machen, fanden jedoch erst in den letzten Jahrzehnten Zugang in den Markt. Zu den Materialien mit Formgedächtniseffekt gehören vor allem Legierungen, also Kombinationen aus zwei oder mehreren Metallen. Besonders bekannt sind Nickel-Titan-Legierungen, die oft als Nitinol bezeichnet werden. Dieser Name leitet sich von den beiden Metallen sowie dem US Naval Ordnance Laboratory, dem Ort wo die Eigenschaften dieser Legierung entdeckt wurden, ab.
Bei der Entwicklung von Anwendungen auf Basis von FGL gingen in der Vergangenheit Werkstoff- und Anwendungsentwicklung immer Hand in Hand. Sowohl die Verbesserung der Werkstoffeigenschaften als auch das bessere Verständnis entscheidender Design-Aspekte führten zu neuen Anwendungen. In der Gruppe der Smart Materials haben FGL neben Piezokeramiken den höchsten Reifegrad. Am Markt existieren, mitunter bereits seit Jahrzehnten etablierte Anwendungen, welche die besonderen Eigenschaften von FGL konsequent ausnutzen. Beispiele hierfür sind FGL-Feder Anwendungen in Fluidkreisläufen und Thermostaten (Stückzahl > 5 Mio. pro Jahr), Pneumatikventile für Sitzkomfortsysteme (Stückzahl > 10 Mio. pro Jahr) und Autofokus- bzw. Bildstabilisierungssysteme in Smartphone-Kameras (Stückzahl > 40 Mio. pro Jahr).
Am IWU wird seit mehr als 15 Jahren im Bereich FGL geforscht. Der Fokus liegt hierbei neben grundlegenden Fragestellungen zur Werkstofftechnik, der Auslegung und der Simulation insbesondere im Bereich Produktionstechnik. Hierdurch kann garantiert werden, dass im Rahmen von Entwicklungen stets die gesamte Wertschöpfungskette, vom FGL-Halbzeug bis zum in Serie gefertigtem Produkt berücksichtigt wird und damit Risiken minimiert werden.
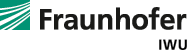 Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

